
Die Rolle der Moderation beim BarCamp
BarCamps stehen für Offenheit, Selbstorganisation und den Austausch auf Augenhöhe. Schließlich ist es ein Konferenz-Format, das ganz bewusst mit klassischen Strukturen bricht – es gibt keine fixe Agenda, keine vorgegebenen Themen, keine One-Way-Kommunikation. Stattdessen gilt: Jede*r darf beitragen, diskutieren, ausprobieren.
Weil es so ein offenes Format ist, brauchen BarCamps eine Moderation. Denn eine gute Moderation schafft den Rahmen, in dem diese Offenheit wirken kann. Sie gibt Orientierung, klärt Erwartungen und sorgt dafür, dass alle Beteiligten gut ins Format finden.
In aller Kürze:
In diesem Artikel erhältst du eine kompakte Übersicht: Warum du bei einem BarCamp nicht auf eine Moderation verzichten solltest, wie diese in die Planung und die Durchführung eingebunden sein sollte – und wen du idealerweise dafür auswählen solltest.
Häufige Fragen – klar beantwortet:
Inhaltsverzeichnis:
- Was macht eine BarCamp-Moderation aus?
- Wozu Moderation, wenn es um Selbstorganisation geht?
- Die Aufgaben der Moderation im BarCamp-Prozess
- Was passiert, wenn niemand moderiert?
- Intern oder extern moderieren?
- Fazit: Gute Moderation macht BarCamps erst richtig wirksam
- Zur Vertiefung
Was macht eine BarCamp-Moderation aus?
BarCamp-Moderation ist nicht mit klassischer Workshop- oder Sitzungsleitung vergleichbar. Es geht nicht darum, Inhalte zu steuern oder Ergebnisse vorzugeben. Stattdessen ist die Moderatorin oder der Moderator eher Prozessbegleiterin, Ermöglicher, Impulsgeberin und Hüter des Rahmens.
Das Ziel: einen sicheren, offenen Raum schaffen, in dem sich alle beteiligen können – unabhängig von Hierarchie, Engagement oder Vorwissen.
Für die Organisatoren bedeutet es zudem oft, mit all den Fragen zu einer erfahrenen Person gehen zu können, den Tag miteinander zu gestalten und beim BarCamp selbst zu wissen, dass der gesamte Prozess in guten Händen liegt.
Wozu Moderation, wenn es um Selbstorganisation geht?
Gerade weil viele Teilnehmende ein BarCamp zum ersten Mal erleben, ist es wichtig, ihnen Sicherheit zu geben. Wie funktioniert das Format? Was wird von mir erwartet? Was darf ich beitragen? Kein fertiges Programm zu haben, ist sowohl für die Organisatoren wie für die Teilnehmenden durchaus eine Herausforderung: Das Publikum schaut auf eine leere Agenda – und fragt sich: Wird das wirklich funktionieren?
Hier hilft die Moderation, denn sie ...
- erklärt den Ablauf nachvollziehbar,
- macht Lust auf Beteiligung,
- räumt mögliche Vorbehalte aus dem Weg und
- gibt dem Ganzen Struktur – ohne es inhaltlich zu bestimmen.
Die Aufgaben der Moderation im BarCamp-Prozess
1. Vor dem BarCamp: Zielklärung, Design, Aufklärung & Einladung
Bereits im Vorfeld beginnt die Arbeit der Moderation – oft gemeinsam mit dem Organisationsteam. Zunächst einmal geht es darum, was mit dem BarCamp erreicht werden soll: Geht es um reinen Austausch und ein gutes Gefühl am Ende des Tages? Oder darum, dass mit den Ergebnissen weitergearbeitet werden soll? Müssen Personen aus dem Umfeld (Verantwortliche, Geldgeber aus dem öffentlichen Bereich, Vorgesetzte etc.) eingebunden werden? Soll es vielleicht eine Keynote zu Beginn (oder einem anderen Zeitpunkt) geben? All diese Fragen werden im Briefing besprochen und dann – meistens von der Moderatorin – erarbeitet.
Außerdem geht es darum, potenzielle Teilnehmende vorzubereiten:
- Was ist ein BarCamp und wie funktioniert es?
- Was erwartet mich – und was wird von mir erwartet?
- Muss ich mich vorbereiten?
- Was ist eine „Session“?
Gerade in Unternehmen, in denen klassische Workshopformate dominieren, ist es wichtig, dieses Format gut zu erklären. Hier kann die Moderation unterstützen – etwa durch ein kurzes Video, einen Info-Call oder einen erklärenden Einladungstext.
Beispiel aus der Praxis:
In einem BarCamp zu einem Nachhaltigkeitsthema kamen viele engagierte Personen zusammen. Die Organisatoren hatten die Sorge, dass es nicht genug Themen geben könnte und wollten Lust darauf machen, Sessionideen zu entwickeln. Ich habe dann bereits im Vorfeld ein Sessionboard erstellt, auf dem mögliche Themenideen gesammelt wurden – das senkte die Hürde deutlich und führte zu einem aktiven Session-Pitch.
2. Eröffnung des BarCamps: Raum schaffen
Bevor es in die Sessionplanung geht, gibt es klassischerweise eine Vorstellungsrunde à la "Mein Name ist Lisa Müller von der Rhein AG. Meine 3 Hashtags sind Personalmarketing, Katzenvideos und Ohne-Kaffee-geht-gar-nichts".
Das ist die klassische Variante, die ich bis zu einer Teilnehmerzahl von bis zu 50 Personen empfehle. Um sicherzugehen, dass nicht doch jemand mit einer langen Vorstellung startet, sollte immer das Orga-Team vorlegen. Dann kann die Moderation auch immer darauf hinweisen, wie es laufen sollte.
Auch bei einer größeren Teilnehmerzahl funktioniert diese Vorstellung – sie verliert nur etwas ihren Charme, weil man sich kaum mehr Stichwörter zu einzelnen Personen merken kann.
Stattdessen nutze ich dann auch die soziometrische Aufstellung oder ich starte mit einer lustigen Fragerunde, die immer für viel Energie und Spaß zum Auftakt sorgt.
Die Sessionplanung
Zu Beginn des BarCamps führt die Moderation in das Format ein: Was ist ein BarCamp, wie läuft der Tag ab, was sind Sessions? Dabei ist Fingerspitzengefühl gefragt – die Einführung soll motivieren, nicht belehren. Humor und persönliche Ansprache helfen dabei.
Anschließend folgt der sogenannte Session-Pitch: Teilnehmende schlagen spontan Themen vor, die sie mit anderen besprechen, diskutieren oder teilen möchten. Die Moderation leitet diesen Prozess, hilft bei Unsicherheiten und achtet darauf, dass alle gehört werden.
Typisch moderative Fragen:
- „Wer hat ein Thema, das er oder sie gern teilen möchte?“
- „Gibt es Fragen oder Ergänzungen zu diesem Vorschlag?“
- „Möchtest du das eher als Diskussion oder als Input gestalten?“
Nach dem Pitch wird gemeinsam ein Session-Plan erstellt – analog mit Post-its oder digital über Tools wie Miro oder Padlet.
3. Während des BarCamps: Prozessbegleitung
Sobald die Sessions starten, tritt die Moderation etwas in den Hintergrund – ist aber weiterhin präsent. Sie achtet auf Zeitmanagement, begleitet Wechselphasen zwischen den Sessions, steht für Fragen zur Verfügung und greift bei Bedarf steuernd ein, wenn z. B. technische Schwierigkeiten auftreten oder Gruppen Unterstützung brauchen.
Gerade bei digitalen oder hybriden BarCamps ist die Moderation oft auch Co-Technikerin, Troubleshooterin und Community Manager*in in einem.
Beispiel:
In einem hybriden BarCamp lief in einer Session der Ton für die Online-Teilnehmenden nicht. Im Moderationsteam konnten wir durch schnelles Eingreifen und Umorganisation eine alternative Lösung finden – so blieb die Gruppe arbeitsfähig.

Meine "Assistentin" bei der Moderation: Die Ziegenglocke
4. Abschluss & Nachbereitung: Reflexion ermöglichen
Zum Abschluss eines BarCamps führt die Moderation eine Reflexion durch. Das kann ein kurzes Blitzlicht sein („Was nimmst du mit?“), eine Feedback-Runde oder eine Auswertung über digitale Tools. Ziel ist es, Raum für persönliche Eindrücke zu geben, aber auch das Format selbst zu reflektieren.
Zusätzlich regt die Moderation die Dokumentation der Ergebnisse an – entweder dezentral durch die Teilnehmenden (z. B. auf Miro-Boards oder in einer Sharepoint-Struktur) oder zentral über das Organisationsteam.
Was passiert, wenn niemand moderiert?
Ein BarCamp ohne Moderation kann funktionieren – wenn alle Teilnehmenden das Format sehr gut kennen, eingespielt sind und intrinsisch motiviert. Das ist allerdings selten der Fall, gerade in unternehmensinternen Kontexten.
Ohne Moderation kann es passieren, dass…
- die Session-Planung ins Stocken gerät,
- sich niemand traut, ein Thema vorzuschlagen,
- Unsicherheiten nicht aufgefangen werden,
- Zeitpläne aus dem Ruder laufen und
- am Ende Frust statt Energie bleibt.
BarCamps leben von Eigeninitiative – aber sie brauchen auch eine gute Struktur. Moderation schafft diese Struktur, ohne einzuengen.
Intern oder extern moderieren?
In manchen Unternehmen gibt es inzwischen interne BarCamp-Erfahrung – hier kann es sinnvoll sein, Mitarbeitende als Moderator*innen zu qualifizieren. Das stärkt Ownership und spart Ressourcen.
Wenn jedoch…
- das Format neu ist,
- viele Hierarchieebenen aufeinandertreffen,
- ein sensibler Change-Prozess begleitet wird oder
- mehrere Standorte beteiligt sind,
…dann ist externe Moderation oft sinnvoller. Sie bringt methodisches Know-how, Unabhängigkeit und einen frischen Blick mit – und schafft oft auch Vertrauen bei kritischen Gruppen.
Mit welchen Kosten du rechnen musst:
Das Honorar für eine externe Moderatorin variiert natürlich je nach den Rahmenbedingungen. Als groben Anhaltspunkt kannst du aber schon einmal folgende Punkte mit einkalkulieren:
- Vorbereitungszeit mit Briefing, Konzeption, Planung
- Moderation des BarCamps
- Fahrt- und Übernachtungskosten
- Optional: Dokumentation und Aufbereitung der Ergebnisse

Wie du eine gute Moderation findest:
- Braucht ihr Unterstützung im Vorfeld, hilft es, jemanden mit einiger BarCamp-Erfahrung in Betracht zu ziehen. Diese Person hat oft einen Blick dafür, wo es haken könnte, wie sich Übergänge gut gestalten lassen, wie lange die Keynote dauern soll und wie sich der Abschluss gestalten lässt.
- Geht es um ein BarCamp zum Austausch und zur Vernetzung, solltet ihr euch nach jemandem umschauen, die Gruppen gut zusammenbringen und motivieren kann. Hier helfen Entertainer-Quailitäten.
- Sollen mit dem BarCamp Prozesse und Aufgaben im Unternehmen bearbeitet und dann auch mit den Ergebnissen weitergearbeitet werden, solltet ihr jemanden suchen, der sich auch mit Facilitation auskennt.
- Die Sprache kann auch noch ein Kriterium sein: Ist dein BarCamp auf deutsch oder englisch?
- Muss es möglichst günstig sein, solltet ihr euch in der Umgebung umschauen: Dann entfallen meistens Fahrt- und Übernachtungskosten. Und auch am Moderationshonorar lässt sich vielleicht etwas machen, wenn die Person nicht erst durch die Republik reisen muss.
- Eine Google-Suche oder auch die KI kann helfen, hier die richtigen Personen genannt zu bekommen. Es lohnt sich aber auch, sich umzuhören und um Empfehlungen zu bitten.
Fazit: Gute Moderation macht BarCamps erst richtig wirksam
BarCamps sind kraftvolle Formate – für Wissenstransfer, Kollaboration und Innovation. Doch ihre Wirksamkeit entfalten sie nur dann, wenn der Rahmen stimmt. Gute Moderation sorgt für Orientierung, Sicherheit und Offenheit. Sie begleitet den Prozess, ohne ihn zu bestimmen – und schafft damit die Grundlage für echte Beteiligung.
Gerade in Unternehmen, in denen Beteiligungsformate noch ungewohnt sind, ist Moderation kein „Nice to have“, sondern ein zentraler Erfolgsfaktor.
Zur Vertiefung:
- Organisation eines BarCamps: Wie du ein BarCamp selbst organisieren kannst, habe ich dir hier einmal zusammengestellt [LINK]
- Corporate BarCamps:Was du bei einem internen BarCamp beachten solltest, habe ich hier zusammengestellt [LINK]
- Digitales BarCamp organisieren: Auch dazu habe ich all meine Erfahrung in einen ausführlichen Blogartikel gepackt [LINK]
- Einen Erfahrungsbericht zu einem Online-Event mit BarCamp-Anteil findest du hier [LINK]
- BarCamp-Liste: Eine Liste aller BarCamps im deutschsprachen Raum findest du hier [LINK]
Bild: Phil Dera

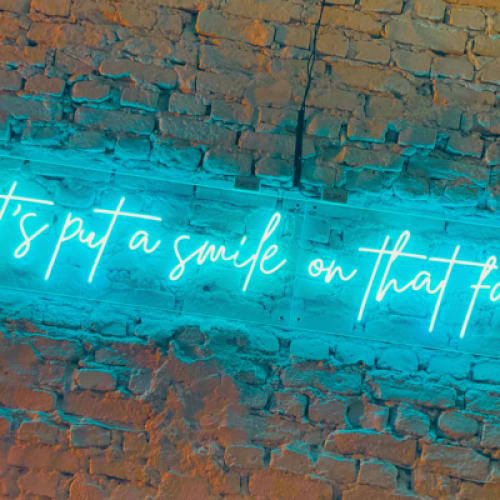


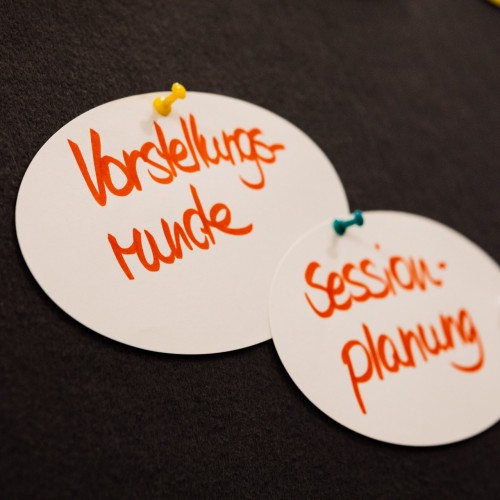


Was denkst du?